Haiku und Tanka sind aus Japan stammende Gedichtformen.
- Das Haiku fordert einen Text von 17 „on” (= Laut, Ton, entspricht am ehesten unserer Silbe) mit einer exakt festgelegten Zeilenverteilung von 5-7-5.
- Beim Tanka, einem 31-silbigen Gedicht, schließen sich noch einmal zwei 7-silbige Zeilen an.
In Sprachen, wo geschriebene Silben zwar bei der Trennung berücksichtigt werden, in der (prosaischen) Aussprache jedoch oft wegfallen, wie z.B. speziell im Französischen, eröffnet dies ganz andere Möglichkeiten als z.B. im Deutschen.
Der Inhalt eines Haiku ist im engen „klassischen” Verständnis, z.B. eines Matsuo Basho, auf reine Naturbetrachtung und auf meditatives Loslassen fokussiert. Die Resultate der hier vorgelegten Sammlung nehmen hingegen alle Themen ins Visier, die sich für eine Reflexion und Verarbeitung „aufdrängen” (sind also streng genommen „senryu”). Der Reiz, den Weg so und nicht anders zu gehen, bestand und besteht in der Herausforderung, Gedanken in einem derart engen Korsett zu fixieren, was für Japaner wie Europäer nur mit einer sublimen „Sprach-Jonglage” zu leisten ist. Das Ergebnis ist hier wie dort eine ebenso „handliche” wie zur Präzision zwingende Form der Mitteilung, die gleichwohl an eine besonders effiziente Nutzung des Raumes „zwischen den Zeilen” gemahnt.
Beispiel für ein Haiku des Meisters Kobayashi Issa
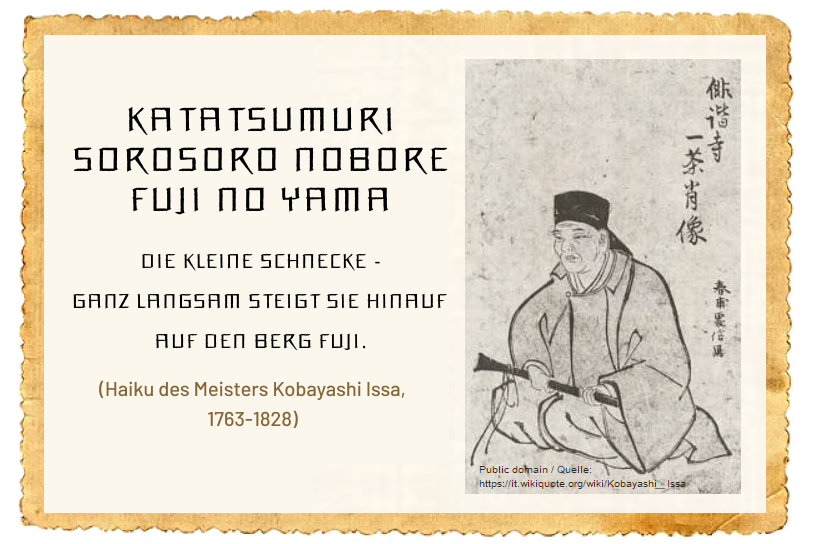
Das Schaffen von Lyrik angelehnt an japanische Formtradition ist in der westlichen Welt seit geraumer Zeit attraktiv. Bei den frühen Tanka dieser Sammlung, initiiert durch eine beinahe beiläufige Erwähnung von Miyamoto Musashi zu Beginn seines „gorin no sho” (Buch der Fünf Ringe), war anfangs nur auf die Einhaltung der Gesamt-Silbenzahl (31) geachtet worden. Im Januar und Februar 2015 wurden alle älteren Tanka auch in die gebotene Versform gebracht (5-7-5-7-7). Zur nicht geringen Überraschung erwies sich dieses „Transponieren” aus der – formal fehlerhaften – Urfassung für die inhaltliche Aussagekraft wie auch für die Stilistik gar als Gewinn.
Beispiel für ein Haiku:
Vom Gipfel zurück
rüttelt bergab der Fallwind
die Fensterläden
(August 2010)

Beispiel für ein Tanka:
Wohl auf dem Zenit
im Glanz der Gipfelsonne
schweift der Blick ringsum
gespannte Erwartung nun
was das Tal noch bieten wird
(Februar 2018)
Im vorliegenden Fall entstand und erwächst die ureigene Motivation, Gedanken exakt in der soeben beschriebenen Form zu bewahren, mit der Absicht, Festzuhaltendes zunehmend bereits „so zu denken”. Insofern kann vom Ziel her betrachtet das, was sich letztlich nicht mit dieser Prägnanz in Form bringen lässt, nicht unbedingt den Anspruch erheben, fixiert und in Raum und Zeit entlassen zu werden.
(Ishisan 2022)
